
Schuleingangsdiagnostik
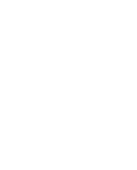
von: Wolfgang Schneider, Marcus Hasselhorn
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, 2018
ISBN: 9783840929267
Sprache: Deutsch
236 Seiten, Download: 2370 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Kapitel 2 Überblick über klassische Verfahren der Schuleingangsdiagnose
Ursula Kastner-Koller und Pia Deimann
Zusammenfassung
Der Wandel des Konstrukts Schuleignung wird anhand des Paradigmenwechsels von endogenistischen Entwicklungstheorien über kontextualistische bis hin zu ökopsychologischen Theorien analysiert und die Auswirkungen dieser konzeptuellen Veränderungen auf diagnostische Instrumente dargestellt. Klassische Verfahren zur Überprüfung der Schulreife und Schulfähigkeit werden ebenso beschrieben wie das Kieler Einschulungsverfahren als typischer Vertreter ökosystemischer Schuleingangsdiagnostika. Die Auswahl der Konstrukte und die methodische Fundierung der Schuleingangstests werden kritisch gewürdigt.
2.1 Von der Schulreife zum systemischen Verständnis des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule
Mit dem Aufkommen der allgemeinen Unterrichtspflicht im 17. Jahrhundert stellte sich die Frage, ab welchem Alter Kinder mit den Kulturtechniken vertraut gemacht werden können. Auch wenn die gesetzliche Schulpflicht in verschiedenen Ländern zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten verordnet wurde, gab es damit die gesellschaftliche Übereinkunft, dass Kinder unterrichtet und ausgebildet werden sollen. Österreich hatte mit der Einführung der sechsjährigen Schulpflicht 1774 unter Maria Theresia diesbezüglich eine Vorreiterrolle, während in der Weimarer Republik der Besuch der vierjährigen Grundschule erst 1920 verpflichtend eingeführt wurde. Obwohl es zunächst in den deutschsprachigen Ländern regional also sehr unterschiedliche Lösungen gab, lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten feststellen. So wurde die Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu erlernen, als ein Reifephänomen aufgefasst, das sich bei gesunden Kindern zwischen fünf und sieben Jahren ohne äußeres Zutun entwickelt. Diese endogenistische Sichtweise auf Entwicklung impliziert, dass die Bereitschaft des Kindes, beschult zu werden, altersabhängig und durch äußere, meist körperliche Merkmale zu erkennen ist. Daraus wurde auch auf die Denkentwicklung geschlossen, da Entwicklung aus endogenistischer Sicht als streng alterskorreliert verstanden wurde.
erste Hochblüte und beschäftigte sich auch mit der Frage der Schulreifediagnostik.
Bühler und Hetzer (1932) entwickelten mit dem Bühler-Hetzer-Kleinkindertest Entwicklungstestreihen für Kinder von 0 bis 6 Jahren, mit denen eine Diagnose der Altersgemäßheit der kindlichen Entwicklung möglich war. Die Altersreihe für 5- bis 6-Jährige zielte darauf ab, kognitive, emotionale und motivationale Aspekte der Entwicklung zu überprüfen, um festzustellen, ob das Kindergartenkind sich bereits zum Schulkind entwickelt hatte. Wenngleich die entwicklungstheoretische Position von Bühler und Hetzer noch eine endogenistische war, nahm ihre Aufgabenauswahl schon mit Weitblick vorweg, was sich in späteren Schulfähigkeitstests wiederfindet. So lässt sich etwa das Testitem „Blättchen Sortieren II“, das von Vorschulkindern verlangte, einen ungeordneten Haufen von roten und gelben Kärtchen der Farbe nach in zwei Schachteln zu sortieren, auch heute noch als Aufgabe zur Überprüfung von Leistungsmotivation, Ausdauer und Konzentration einordnen.
Erste Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Alterskriteriums äußerte z. B. Kern (1963) in seinem Klassiker Sitzenbleiberelend und Schulreife. Er beschäftigte sich mit dem Zusammenhang zwischen Schulreife und Schulleistung. Eine empirische Analyse von Grundschülern der Nachkriegsjahre ergab, dass ein Drittel bis ein Viertel der 6-Jährigen sich im Frühstadium der Schulreife befand und damit als nicht schulreif einzuschätzen war. Etwa 40 % der Kinder ordnete Kern dem Mittelstadium zu, der Rest befand sich im Spätstadium und war damit voll schulreif. Weitere empirische Analysen zeigten einen hohen Zusammenhang zwischen Schulreifestadium und Schulleistung mit deutlich besseren Schulleistungen bei voll schulreifen Kindern und einem hohen Anteil an Schulversagern bei Kindern im Frühstadium der Schulreife (vgl. Kern, 1963). „Es ist undenkbar, daß der große Teil der Sitzenbleiber das Schulziel wegen schwacher Begabung nicht erreicht. Es muss als völlig ausgeschlossen angesehen werden, daß nahezu ein Drittel des deutschen Volkes so wenig begabt ist, daß es den schulischen Forderungen nicht gewachsen ist“ (Kern, 1963, S. 13). Reifungstheoriekonform forderte Kern aber die Zurückstellung von nicht schulreifen Kindern und ein Abwarten, bis sich die notwendige Reife einstelle. Zur Einschätzung, ob ein Kind schulreif sei oder nicht, schlug er als neues Kriterium die sogenannte Gliederungsfähigkeit vor. Darunter verstand er die heranreifende Fähigkeit, Gestalten in unterschiedlichen Modalitäten (visuell, akustisch, numerisch) differenziert und detailliert wahrzunehmen und genau reproduzieren zu können. Diese Fähigkeit in voller Ausprägung kennzeichnete nach Kern das voll schulreife Kind im Spätstadium (vgl. Kern, 1963). Mit dem Grundleistungstest legte er einen Schulreifetest vor, dessen Ziel es war, anhand der Gliederungsfähigkeit als einzigem Kriterium nicht schulreife Kinder zu selektieren und zurückzustellen. Kern unterschied zwar schon zwischen intellektueller und sozialer Reife, sah aber beide in einem engen entwicklungsbedingten Zusammenhang.







