
Moralische Entwicklung und Erziehung in Kindheit und Adoleszenz
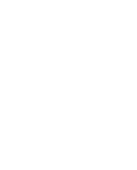
von: Brigitte Latzko, Tina Malti
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, 2010
ISBN: 9783840922268
Sprache: Deutsch
337 Seiten, Download: 3234 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Es ist die große Leistung Kants, dass er nicht nur versuchte, die Moral auf der einen Seite von der Religion zu trennen, indem er sie auf das rein rationale Prinzip der Verallgemeinerung gründete, das er im kategorischen Imperativ formulierte. Sondern auch, dass er dabei sehr konsequent bemüht war, die Ethik gerade von allen „anthropologischen Fakten rein zu halten“ (Kant, 1785, IV, 389, S. 8 f.). Moral war für ihn eine regulative Idee, sie war deshalb kontrafaktisch; sie sagt, wie die Welt sein soll, nicht, wie sie ist. Die Spannung zwischen der ethischen Norm und der empirischen Hypothese gilt deshalb verschärft, wenn es darum geht, diese regulativen Ideen in ihrer Bedeutung für reale Lebenskontexte zu bestimmen.
Im Folgenden wird zunächst der Kontextbegriff als solcher geklärt. Dabei wird sich letztlich zeigen, dass sich das Kulturkonzept als ein idealer Kandidat für das Verständnis des Kontexts des Menschen anbietet. Ein als Kontext verstandener Kulturbegriff führt dann allerdings in eine Transformation der Psychologie in eine Kulturpsychologie. Auf der Suche nach einer dem Gegenstand angemessenen Theorie einer Kulturpsychologie werden sich dann insbesondere transaktionale, speziell handlungstheoretische Ansätze eignen. Der Kulturbegriff wird jedoch nicht nur das Wesen des Kontexts systematisch zu präzisieren helfen, sondern auch den Zusammenhang zwischen Kultur und Moral und damit den Zusammenhang zwischen Kontext und Moral. Diesen Zusammenhang werden wir dann speziell für die Theorie Kohlbergs weiter ausbauen, sie wird in der Formulierung der „alltagsweltlichen Moraltypen“, also der eigentlichen Kontextualisierung moralischer Urteile gipfeln.
1.1 Kontext
Graumann (2000) macht deutlich, dass Kontext nicht nur „Umgebung“ sondern auch „Zusammenhang“ meint. Diese Begriffsbestimmung ist essentiell, denn sie impliziert, dass in ihr ein verwandtes epistemologisches Problem steckt, wie es bereits in der gestaltpsychologischen Kritik an einer elementaristischen Psychologie gegeben war (vgl. Wertheimer, 1925). Der Titel dieses Kapitels will deshalb an diese Tradition der Beziehung zwischen dem Ganzen und den Teilen anschließen und dieses Verständnis auf die Beziehung zwischen Zusammenhang und Umgebung in der Psychologie anwenden.
Das zergliedernde, analytische Denken und das Experiment als Königsweg für den Nachweis kausaler Prozesse im 19. Jh. stand auch Pate bei der entstehenden Psychologie im Ausgang dieses Jahrhunderts. Auch wenn die jüngere Rezeption von Wundt (Jüttemann, 2006) zeigt, dass Wundt (z.B. 1911) zwar die Methode des Experimentes (in Form des willkürlichen Eingriffs in die Erfahrung) auch für die Analyse grundlegender psychischer Erfahrungen verwendete, so ist heute doch auch klar, dass bei Wundt der Experimentalpsychologie nur eine basale, ergänzende Funktion zukam, denn es gäbe psychologische Gegenstände, „die der Natur der Sache nach dem Experiment unzugänglich sind“ (Wundt, 1913, S. 29). Dazu gehörten nach seiner Meinung die Entwicklung des Denkens, die künstlerische Phantasie, Mythen und Religion und hier besonders wichtig: auch die Moral. Wundt steckte also bereits in dem von Boesch so trefflich benannten Dilemma. Bereits früh ist also klar, dass Kontext im Verständnis einer Psychologie, die dem zergliedernden analytischen Denkansatz folgt, auf Umgebung reduziert wird, und zwar in Form einer oder mehrerer (unabhängiger) Wirkvariablen, die kausal auf psychologische Prozesse und Funktionen sowie ihre Veränderung wirken.
Auf der anderen Seite gibt es bekanntlich bereits in der frühen Psychologie eine Gegenposition zum „Elementarismus“ in dem explizit formulierten Diktum der Gestaltpsychologie (Ehrenfels, 1890; Wertheimer, 1925), dass „das Ganze etwas anderes als die Summe seiner Teile“ sei, eine Sicht, die bis Aristoteles (350 v. Chr.)2 und Konfuzius (500 v. Chr.)3 zurück reicht. Diese Sicht griff keineswegs nur in der Gestaltpsychologie, sondern sie führte besonders in der Biologie zur Abkoppelung von physikalistischen Denkmustern (Mayr, 1991) und später konsequent zur Systemtheorie und damit zu einer Dominanz anderer erklärender Konzepte als der Kausalität: Komplexität, Gleichgewicht, Rückkopplung, Selbstorganisation und Emergenz (vgl. Bertalanffy, 1950; Driesch, 1912; Maturana & Varela, 1987). In diesen Ansätzen ist Kontext nun nicht mehr nur Umgebung, sondern auch Zusammenhang. Diese Sichtweisen beeinflussten natürlich auch die Denkmuster in der Psychologie. Tatsächlich war mit dem „Rückzug ins Labor“ auch in der Psychologie zwar eine Präzisierung der Bestimmung der Umgebung (als manipulierter Wirkvariablen) aber gleichzeitig das Problem des Verlustes des Zusammenhanges gegeben – nur hieß es das Problem der „externen Validität“ experimenteller Ergebnisse, also ihre Verallgemeinerbarkeit auf den Alltag. Konsequent führte dieser Verlust international und national zu einer immer lauter werdenden generellen Forderung einer Kontextualisierung psychologischer Forschung (Barker, 1969; Graumann, 1978; Kaminski, 1976). Besonders prominent wurde Juri Bronfenbrenners (1989) Vorschlag eines ökologischen Modells, das im Wesentlichen aus verschiedenen Systemebenen bestand.4 Dieses Denkmodell ist also offensichtlich ein erster Kandidat für das Verständnis von Kontext als Umgebung (die verschiedenen Ebenen) und Zusammenhang (als Systemebenen).
Allerdings bergen diese Ansätze zwei Probleme (Eckensberger, 2008): (1) Die verschiedenen „Systemebenen“ (Umweltbedingungen) z.B. im Modell Bronfenbrenners waren im Prinzip auch ohne dieses „Modell“ seit langem in der Literatur präsent. So ist es durchaus fraglich, ob diese „Ebenen“ den Begriff der „Systeme“ wirklich verdienen, ob ihre systemterminologische Benennung tatsächlich einen theoretischen Fortschritt enthält. (So werden für die Systemtheorie wichtige Fragen keineswegs geklärt, etwa: Welcher Natur sind die Wechselwirkungen zwischen den Ebenen? Wie entstehen diese Ebenen, emergieren sie auseinander? Welche Mechanismen der Emergenz werden angenommen? Gibt es Gleichgewichtszustände zwischen den Ebenen und den psychischen Prozessen? etc.). (2) Zudem, und dieses Problem wiegt noch schwerer, ist bereits seit den ersten grundlegenden Publikationen der Systemtheorie (z.B. Bertalanffy, 1958) durchaus fraglich, ob sich der Systembegriff der Biologie überhaupt auf alle Gegenstandsbereiche, in Sonderheit auf die Psychologie angemessen anwenden lässt, ob also aus der „phylogenetischen Kontinuität“ der biologischen Systeme (inklusive des Menschen) zwingend eine „epistemologische Kontinuität“ folgt (Bertalanffy, 1958; Thayer, 1972).
Überraschenderweise führt damit die scheinbar einfache Forderung nach Kontextualisierung der Psychologie allgemein und der Moral speziell in die Frage nach ihrem Gegenstand und Selbstverständnis schlechthin. In einer Reihe von metatheoretischen Arbeiten habe ich in einer konstruktivistischen Einstellung (z.B. Schmidt, 1987), zu argumentieren versucht, dass dieser Gegenstand nicht durch seine Ontologie, sondern durch die Perspektive (epistemologische Position) konstituiert wird, die man auf ihn einnimmt. Ich habe z.T. im Anschluss an andere Autoren (vor allem Reese & Overton, 1970) vier Perspektiven unterschieden: Eine mechanistische (homo mechanicus), eine organismische (homo sapiens), die Perspektive des potentiell selbstreflexiven intentionalen Subjektes (homo interpretans) und die kulturwissenschftlich-historische (animal symbolicum). Dabei sind die beiden ersten in der Regel den Naturund die beiden letzten den Kulturwissenschaften zugeordnet. Snow (1963) unterschied in seiner berühmten Cambridge Vorlesung diese Perspektiven als zwei wichtige aber unterschiedliche Arten der Weltinterpretation und spricht von zwei (wissenschaftlichen) Kulturen. Mack (2006) nennt diese im Anschluss an Dilthey (1894/1968) und Schmidt (1995) „Eund V-Denkstile“, einen erklärenden und einen verstehenden Denkstil, und macht deutlich, dass auch diese Unterscheidung bereits bei Wundt, also gewissermaßen an der Wiege der Psychologie, in der Sache getroffen wurde, ebenso wie eine an Brentano anschließende Diskussion einer „voluntaristischen“ Komponente. Er macht deutlich, dass Wundt die Psychologie weder als Naturwissenschaft verstand, auch nicht als Kontrast zur Naturwissenschaft als Geisteswissenschaft, sondern als eigenständige Disziplin, die von beiden partizipiert. Diese frühen Argumente halte ich für sehr modern in dem Sinn, dass sie auch heute vor der vorschnellen Lösung des Dilemmas bewahren, den Gegenstand der Psychologie reduktionistisch zu verkürzen. Sie machen aber auch deutlich, dass die naturwissenschaftliche (biologisch fundierte) Systemtheorie, trotz ihrer Attraktivität für einen psychologischen Kontextbegriff, bestenfalls einäugig ist. Dies gilt damit ebenso für den Versuch, die Moral aus biologischen oder systemtheoretischen Kategorien zu entwickeln (vgl. bereits Stent, 1979). Innerpsychologisch sind auch moralische Urteile in einer phänomenologischen, kognitiven oder rationalen (interpretativen)







