
Grenze und Demokratie - Ein Spannungsverhältnis
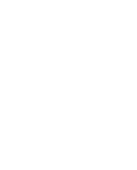
von: Nele Kortendiek, Marina Martinez Mateo
Campus Verlag, 2017
ISBN: 9783593436296
Sprache: Deutsch
249 Seiten, Download: 2535 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Einleitung: Grenze und Demokratie
Marina Martinez Mateo und Nele Kortendiek
In der Demokratie ist eine strukturelle normative Ambivalenz angelegt. Als staatliches oder staatsähnliches System ist eine demokratische Ordnung auf Grenzziehung angewiesen, insofern sie innerhalb eines bestimmten Territoriums organisiert ist. Weitergehend ließe sich sogar annehmen, dass die Schließung nicht nur als Effekt der staatlichen Einbettung von Demokratie verstanden werden muss, sondern in der Idee von Demokratie selbst verankert ist: Soll sie Herrschaft des Volkes sein, muss dieses Volk zunächst bestimmt werden. Dazu wird es in jene, die Mitglieder sind und regieren dürfen, und solche, die davon ausgeschlossen sind, unterteilt. Demokratie beruht auf einer klar abgegrenzten Gemeinschaft und bedarf Mechanismen der Schließung, die diese Gemeinschaft konstituieren und als bestimmte aufrechterhalten. Demokratie ist somit eine Rechtfertigungsordnung für staatliche Grenzziehungen. Umgekehrt müsste aber gerade eine demokratische Praxis darin bestehen, abgegrenzte Ordnungen in Frage zu stellen und zu durchbrechen: Worin könnte der Demos politisch wirksamer sein als in seinem spontanen Aufbegehren gegen die Herrschaftsstrukturen des Staates und seine Grenzziehungen? Nimmt man die Bezugnahme auf Freiheit und Gleichheit in der Normativität von Demokratie ernst, so muss der Protest gegen den Ausschluss, der in der Unterscheidung von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern enthalten ist, zumindest mitgemeint sein können. Demokratie ist also zugleich ein Rechtfertigungsnarrativ für die Formulierung normativer Ansprüche seitens derer, die sich als von der demokratischen Ordnung ausgeschlossen sehen. Von dieser Annahme ausgehend, lassen sich Praktiken der Grenzüberschreitung und -verwischung demokratisch deuten, auch wenn sie gar nicht so intendiert sein mögen. Es ließe sich dann von einem demokratisierenden Gehalt der Migration sprechen oder davon, dass Subjektivitäten, die zwischen den Welten entstehen, in besonderer Weise als zur Demokratie befähigt erscheinen.
Von dieser Ambivalenz zwischen demokratischer Grenzziehung und Entgrenzung wollen wir in diesem Sammelband ausgehen - nicht um uns auf eine der beiden Seiten zu schlagen und eine 'gute' gegen eine 'schlechte' Demokratie auszuspielen, sondern um zu zeigen, dass sie die Demokratie vor weitreichende Herausforderungen stellt. Aus dem wechselseitigen Verhältnis der Eingrenzung und Überschreitung ergibt sich eine 'performative Spannung zwischen Rechtfertigungsansprüchen und geronnener Ordnung', der sich die Demokratie stellen muss, um ihrem normativen Gehalt politische Wirksamkeit zu verleihen. Dies ist die Perspektive, aus der heraus der vorliegende Sammelband entstanden ist. Er sucht nach kreativen Lösungsansätzen, um die widersprüchlichen normativen Anforderungen der Öffnung und Schließung miteinander ins Gespräch zu bringen.
Die besondere Dringlichkeit dieses Vorhabens zeigt sich derzeit insbesondere anhand der erstarkten Migrations- und Fluchtbewegungen, die von demokratischen Systemen einfordern, sich akut mit Fragen des Aus- und Einschlusses auseinanderzusetzen. Laut dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen seit Beginn des Jahres 2015 knapp 1,4 Millionen Menschen über die See- und Landgrenzen nach Europa. 1,26 Millionen Menschen stellten einen Asylantrag in europäischen Mitgliedsstaaten. 10 Millionen Menschen waren im Jahr 2015 staatenlos, 24,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hinzu kommen zahlreiche undokumentierte Grenzüberschreitungen. Die UN sprechen für 2015 von insgesamt 244 Millionen Migrant_innen, dem höchsten Stand seit Beginn der 1960er Jahre. Diese Zahlen spiegeln das Ausmaß menschlicher Mobilität, die sich von geographischen Grenzlinien nicht aufhalten lässt und auch durch intensivierte staatliche - zum Teil extraterritorial organisierte - Grenzkontrollen nicht zu verhindern ist (für eine exemplarische Beschreibung unautorisierter Grenzüberschreitungen trotz begrenzender Politiken siehe Picozza in diesem Band). Migrationsforscher_innen stellen angesichts dieser konstanten und weltumfassenden Bewegungen fest, dass Migrationspolitiken, die auf die Begrenzung eines Zustroms von Menschen zielen, ins Leere laufen, da die Adressat_innen dieser Regelungen, als aus dem Demos Ausgeschlossene, die Legitimität und folglich die Autorität dieser nationalen Abgrenzungsanweisungen nicht anerkennen.
Migrant_innen entziehen sich in ihren Grenzübertretungen also staatlichen Kontrollen und Herrschaftsansprüchen und verlangen gleichzeitig nach politischer und sozialer Integration. Auf Grundlage der Kernnormen demokratischer Ordnungen formulieren sie normative Ansprüche, denen diese Ordnungen als solche nicht entsprechen (können). Sollten Demokratien in der Folge die Normalität der Migration anerkennen und die Prämisse der Sesshaftigkeit, die tief im Rechtfertigungsnarrativ des Nationalstaates und der Demokratie verankert ist, aufgeben? Da wir im 'Zeitalter der Migration' leben, sollte möglicherweise auf jede Eingrenzung von demokratischen Ordnungen verzichtet werden. Zugleich rüttelt dies auf fundamentale Weise an der Normativität der Demokratie selbst, denn dies kann nicht geschehen, ohne die Idee der Selbstregierung bis zur Unkenntlichkeit auszuhöhlen. Wie ist also damit umzugehen, dass einerseits physische Grenzziehungen stets überschreitbar zu sein scheinen und andererseits die Rechte und Werte, die staatlich organisierten Demokratien das normative Fundament bieten, an Staatsbürgerschaft gekoppelt sind?
Bestehende Demokratien werden durch Flucht- und Migrationsbewegungen ganz praktisch und akut vor die Frage gestellt, wie mit den widersprüchlichen Anforderungen der Grenzöffnung und -schließung umzugehen ist. Die politischen Antworten darauf, die derzeit dominieren, gravitieren allerdings weg von einer möglichen Öffnung hin zu einer zunehmenden Abgrenzung nach außen. In demokratischen Volksabstimmungen äußerten sich zuletzt die Bürger_innen der Schweiz und Großbritanniens in den Referenden zur 'Ausschaffungsinitiative' und zum 'Brexit' gegen eine zunehmende Integration von Zugezogenen. Sie stimmten für eine erleichterte Abschiebung von Ausländer_innen bzw. für einen nationalen Ausschluss aus der supranationalen politischen Gemeinschaft der Europäischen Union (EU), um einer weiteren Immigration zu entgehen. Auch in dem in Ungarn durchgeführten Referendum zur EU-Flüchtlingspolitik zeigte sich der Versuch eines Rückzugs ins Nationale über den Weg der Abgrenzung. Deutschland öffnete angesichts der großen Fluchtbewegung im Sommer 2015 zwar kurzfristig seine physischen Grenzen, um Schutzsuchende aufzunehmen. Parallel wurde jedoch das Asylrecht verschärft, die normativen Grenzen gegenüber Migrant_innen also verdichtet. So haben diese zwar Zugang zum Territorium Deutschlands erhalten, vom Demos bleiben sie hingegen weiterhin ausgeschlossen.
Demokratisch verfasste Staaten üben ihre Souveränität derzeit folglich in der Abschottung aus. Im Widerstreit zwischen einem Universalismus demokratischer Kernnormen und der Begrenzung demokratischer Systeme entscheiden sie sich für die Schließung und nehmen dazu die Abwertung grundlegender Rechte und Prinzipien in Kauf. Auch das temporäre Aussetzen des Schengener Abkommens und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums zeugen von dieser Entwicklung. Schließlich scheint auch jenseits von Europa Ausgrenzung die aktuelle Antwort auf zunehmende Immigration zu sein und nicht die Einlösung demokratischer Versprechen von Freiheit und Gleichheit. In den USA wird die Idee einer Grenzmauer zu Mexiko zum Wahlkampfthema; in Australien lagert die demokratische Regierung Immigrant_innen auf die Inseln Nauru und Manus jenseits seines Staatsterritoriums aus (zur Debatte um diese Form der territorialen Ausgrenzung siehe Gebhardts Artikel in diesem Band). Diese politischen Trends einer sich beschleunigenden Dialektik von Grenzübertretung und -schließung weisen auf die besondere Relevanz hin, sich verstärkt mit Demokratie im Verhältnis zu ihren Grenzen und deren Auflösung auseinanderzusetzen und danach zu fragen, wie sie als normative Ordnung angesichts dieser Entwicklungen Bestand haben kann.
Weiterhin weisen die aktuellen Verhältnisse auf die Spannung zwischen Demokratie und Menschenrechten hin. Die derzeit dominierende Abschottungspolitik zeugt nicht nur von dem Versuch, die Identität und Funktionalität des Demos zu bewahren und sich vor einer vermeintlichen 'Überfremdung' zu schützen. Sie verdeutlicht außerdem, dass die Menschenrechte diesem Ziel untergeordnet werden. Die Rechte von Migrierenden, und nicht zuletzt das fundamentale Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, werden häufig missachtet, wenn es darum geht, die territoriale, soziale und politische Grenze des demokratischen Kollektivs aufrechtzuerhalten. So kollidiert der normative Anspruch der Demokratie, grundlegende Rechte zu gewähren und zu schützen, mit ihrer Begrenzung. Die berühmte Kritik der Menschenrechte, die Hannah Arendt formulierte, zeigt diese Dissonanz auf: Die Menschenrechte werden gerade von denjenigen gebraucht, die nicht als Staatsbürger_innen anerkannt sind und in der Folge diese Rechte nirgends einfordern können. Ohne Staatsbürgerschaft, das heißt ohne Bürgerrechte, bleibt auch die Gewährung von Menschenrechten prekär (diese Spannung zwischen Menschen- und Bürgerrechten diskutiert Colliot-Thélène ausführlich in ihrem Beitrag zu diesem Band). Dass darin ein eingeschränktes Verständnis sowohl von Menschenrechten als auch von Demokratie liegt, weil es beides als Gegensatz versteht, zeigt Klaus Günther. Hingegen, so sein Plädoyer, können 'Menschenrechte nur im Wege einer alle Menschen einschließenden Selbstbestimmung interpretiert und fortentwickelt werden'. Darin liegt eine der normativen Herausforderungen, vor die Migration Demokratien stellt.
Diese Ambivalenzen zwischen Grenze und demokratischer Ordnung stellen seit einiger Zeit ein zentrales Thema in der Politischen Theorie und normativen Theorien der Internationalen Beziehungen dar. Zunehmend zeigt sich, dass die Bindung von Demokratie an den Nationalstaat mindestens unzureichend ist: Es erweisen sich innerhalb nationalstaatlicher Rahmungen immer mehr Probleme als unlösbar und entsprechend gibt es ein Erstarken politischer Strukturen und Institutionen jenseits des Nationalstaates, die demokratische Legitimität für sich beanspruchen. Dies stellt die Demokratietheorie vor die Herausforderung eines neuen Umgangs mit territorialen und nationalen Grenzen und erfordert auch die Entwicklung neuer Formen der Partizipation und Repräsentation jenseits hergebrachter Verfahren, denn 'normative Ordnungen [können sich] auch dort, wo sie die Grenzen des Staates überschreiten, [den] Anforderungen [der Demokratie] nicht entziehen'.
Die Debatte um ein solches 'Boundary Problem in Democratic Theory' greift auf Robert Dahl zurück, der bereits 1970 thematisierte, es gäbe in der Demokratietheorie eine bemerkenswerte Ausblendung der Frage, wie darüber zu entscheiden sei, wer zum Demos gehört. Dass diese Frage nicht einfach vergessen wurde, sondern dass die Schwierigkeiten, sie zu beantworten, konzeptionell mit dem Verständnis von Demokratie zusammenhängen, wurde in den letzten Jahren vermehrt aufgezeigt. Denn soll die Frage nach der Zugehörigkeit zum Demos auf dieselbe Weise demokratisch beantwortet werden wie Fragen innerhalb eines konstituierten Zusammenhangs, das heißt prozedural mit Rückgriff auf die Souveränität eines Volkes, entsteht offenbar ein unendlicher Regress: Welches demokratische Kollektiv ist dazu legitimiert, über die Kriterien der Bildung eines demokratischen Kollektivs zu entscheiden? Eine Gegenstrategie wäre, anstatt auf ein weiteres 'Wer' zurückzugehen, nach allgemeinen demokratischen Prinzipien und Verfahren zu suchen, die sich zur Bestimmung eines Demos anwenden lassen - also auf die Ebene des 'Wie' zu wechseln.
Konkret steht in diesen Debatten die Verknüpfung von Demokratie und Volkssouveränität zur Diskussion. Das Verständnis von Demokratie als Selbstregierung des Volkes - nicht nur begrifflich offenbar nahegelegt, sondern auch mindestens seit Rousseau das dominante legitimierende Narrativ der Demokratie - birgt möglicherweise konzeptionell schon, erst recht aber unter heutigen Umständen Probleme: Denn es wird fraglich, wer eigentlich dieses demokratische Volk ist, das für souverän erklärt wird. Unter dem Paradigma der Volkssouveränität ist diese Frage nicht zu beantworten, da es in dessen Rahmen immer schon ein Volk geben muss, in dem die Souveränität liegt. Implizit oder explizit wird dadurch ein Nationalstaat (oder ein staatsähnliches souveränes Gebilde) vorausgesetzt. Dadurch liege der Kern der Volkssouveränität, so die Kritik, in der bloßen ideologischen Fiktion zur Legitimierung staatlicher Herrschaft, da es zunächst den Staat geben müsse, der das souveräne Volk und dessen Willen bestimmt. Dennoch muss das Volk, damit es als legitimierende Grundlage dient, als dem Staat vorgängig erscheinen und somit naturalisiert werden. Der Staat bildet den unhintergehbaren, gleichsam natürlichen Rahmen für die Ausübung kollektiver Autonomie. Die Bedingungen für die Zugehörigkeit zum Demos werden entpolitisiert: Sie sind eine Frage der Geburt und nicht Gegenstand demokratischer Aushandlung. Eine Verteidigung der Volkssouveränität findet sich auf der anderen Seite etwa bei Ingeborg Maus: Von Beginn an sei die Idee der Volkssouveränität mit einer Entgrenzung des Volks verbunden gewesen, da nicht mehr die traditionalen, ethnisch-kulturellen Grenzen des Nationalstaats das politische Kollektiv bestimmten, sondern dessen politische Aktivität selbst. Die 'Entsubstantialisierung' und Prozeduralisierung des Volks enthalte die Möglichkeit, dass es sich kontinuierlich neu definiere. Umgekehrt sei es gefährlich, eine nationalstaatlich organisierte Volkssouveränität zugunsten einer vagen Idee globaler Demokratie aufzugeben, da es nur auf ihrer Grundlage möglich sei, die Macht internationaler Institutionen zu begrenzen.
Spätestens seit den 1990er Jahren beschäftigen diese Fragestellungen die Literatur intensiv, da der methodologische Nationalismus und die Eingegrenztheit demokratischer Gemeinschaften mit dem Ende des Kalten Krieges an Selbstverständlichkeit verloren. Es ist also kein Zufall, dass diese Debatte in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Erst auf der Grundlage einer sich beschleunigenden Transnationalisierung, durch die nationalstaatliche Grenzen zusehends porös wurden und neue politische Zusammenhänge auftraten, in denen Fragen demokratischer Regierbarkeit virulent wurden, konnte die Frage nach den Grenzen des Demos kreativ und produktiv erörtert werden. Die These, dass in der Folge der Globalisierung eine zunehmende Denationalisierung politischer Entscheidungsfindung stattfand, wurde zum Ausgangspunkt für zahlreiche Entwürfe einer demokratischen Neuordnung der postnationalen Konstellation. Die Unmöglichkeit einer Regulierung globaler Probleme innerhalb nationalstaatlicher politischer Ordnungen und das Auftreten demokratischer Externalitäten drängten dazu, nach demokratischen Mechanismen jenseits des Staates zu suchen. Ebenso verlangten neue globale politische Institutionen, die im Zuge einer Verschiebung vom zwischenstaatlichen Regieren hin zur global governance an Autorität gewannen, nach demokratischer Legitimation. Diese neuen Problemstellungen verliehen der Debatte um die Öffnung und Schließung der Demokratie neue Impulse und rückten auch die Frage nach der Rechtfertigung von Grenzen verstärkt ins Zentrum. Da diese immer weniger als natürliche Rahmungen der sozialen und politischen Ordnung in Erscheinung treten, drängt sich die Frage in den Vordergrund, warum sie als Maßstab für demokratische Teilhabe gelten sollen.
So diskutieren kritische Ansätze der Internationalen Politischen Theorie die mangelnde Gerechtigkeit national-territorial organisierter Demokratien. Sie argumentieren, dass eine solche Abgrenzung der Demokratie immer zu einem Ausschluss politischer Partizipation führt und die öffentliche Autonomie exkludierter Gruppen beschneidet. Die aus der nationalstaatlichen Demokratie Ausgeschlossenen werden an politischen Aushandlungsprozessen nicht beteiligt, obgleich von deren Ergebnissen betroffen, was dem Grundsatz der Selbstbestimmung widerspricht (für eine ähnliche Kritik siehe Banerjee in diesem Band). Autor_innen dieser Stoßrichtung fordern daher transnationale politische Zusammenhänge, die der Tatsache Rechnung tragen, dass Menschen auch in einer wirtschaftlich entgrenzten Welt sozial verbunden sind, und so die Mitwirkung aller Betroffenen ermöglichen. Der politischen Ausgrenzung und Entrechtung, die tief im Westfälischen Staatensystem verankert ist, soll insbesondere über eine Transnationalisierung der Öffentlichkeit entgegen gewirkt werden. In der Deliberation läge die Möglichkeit, über die Grenzen bestehender politischer Gemeinschaften hinweg in Rechtfertigungsbeziehungen zueinander zu treten und gemeinsam verbindliche Regelungen für globale Fragen auszuhandeln, ohne auf einen klar umrissenen Demos oder quasi-staatliche globale Institutionen zurückgreifen zu müssen. Dabei vertrauen deliberative Entwürfe transnationaler Demokratie auf eine global wirkende Zivilgesellschaft, die unabhängig von nationalen Zugehörigkeiten sowohl eine transnationale öffentliche Meinung ausbilden, als auch globale Entscheidungfindungsprozesse überwachen und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen könne. Offen bleibt in diesen Modellen jedoch zumeist, wie ein gleicher und freier Zugang zum Diskurs tatsächlich gewährleistet und eine transnationale öffentliche Meinung in Entscheidungs- und Implementierungsstrukturen zurückkanalisiert werden kann.
Kosmopolitische Demokratietheorien hingegen setzen näher an einem staatlich-institutionellen Verständnis von Demokratie an. Sie entwerfen ein Mehrebenensystem, innerhalb dessen, dem Grundsatz der Subsidiarität folgend, Entscheidungsmöglichkeiten jenseits des Staates eröffnet werden, die einen Ausschluss aus demokratischen Verfahren der Entscheidungsfindung zumindest minimieren. Durch eine kosmopolitische Bürgerschaft, die Staatsbürgerschaften ergänzt oder ersetzt, sollen Individuen neue Partizipationsrechte zugesprochen und politische Mitbestimmungsräume jenseits des Staates geschaffen werden. Ausgehend von der moralischen Gleichwertigkeit aller Menschen, die eine Exklusion aufgrund von Nationalitäten und Staatszugehörigkeiten prinzipiell ausschließt, wird ein Modell globaler Demokratie vorgeschlagen, das insbesondere durch eine Reform der UN und anderer internationaler Organisationen, die Etablierung regionaler Parlamente sowie die Stärkung der Menschenrechte erreicht werden soll. Autor_innen dieser Tradition können sich jedoch dem Vorwurf einer bloßen Reproduktion westlicher staatlicher Strukturen auf globaler Ebene nicht erwehren und auch dem Problem eines fehlenden globalen Demos nicht erfolgreich entgehen. Nicht nur kommunitaristische Theorien werfen kosmopolitischen Ansätzen vor, das für eine Demokratie notwendige gemeinschaftsstiftende Moment aus den Augen zu verlieren. Auch Jürgen Habermas gesteht ein, dass ein universeller kosmopolitischer Demos stets daran scheitern wird, dass er sich in seiner totalen Inklusion nicht nach außen hin abgrenzen und somit keine Bestimmung seiner selbst vornehmen kann. Selbst die Umstellung auf einen kosmopolitischen Verfassungspatriotismus kann diesen Mangel an Zugehörigkeitsgefühl nicht überbrücken.
Dieser kurze Abriss zeigt, dass das Spektrum verschiedener Optionen, das in der transnationalen Demokratietheorie diskutiert wird, insgesamt auf eine größere Fluidität des Demos hinausläuft, der sich punktuell in Bezug auf verschiedene Fragen immer wieder neu definieren lassen soll, wodurch auch die mögliche gleichzeitige Zugehörigkeit zu verschiedenen Demoi einbezogen wird. Einer Erneuerung des klassischen volksouveränen Modells, das einfordert, dass all diejenigen, die einem Gesetz unterworfen sind, darüber auch mitentscheiden dürfen (das 'all-subjected-Modell') stehen demnach Modelle gegenüber, die danach fragen, wer von den Konsequenzen politischer Entscheidungen betroffen ist (das 'all-affected-principle'). Da sich dies je nach Entscheidung, die auf der politischen Tagesordnung steht, ändern kann, kann sich auch die Zusammensetzung des regierenden Demos jeweils verschieben. Wie genau solche fluiden Demoi zu bestimmen sind und wie ihre jeweilige Bildung praktisch organisiert werden kann, bleibt jedoch weiterhin offen.
Ähnliche Neu-Entwürfe gibt es in Bezug auf politische Repräsentation. Unter Bedingungen der Globalisierung und abnehmenden Bedeutung des Nationalstaats muss Repräsentation von ihrer Bindung an parlamentarische nationalstaatliche Strukturen befreit werden, um stattdessen eine größere Vielfalt möglicher repräsentativer Institutionen und Wege der Autorisierung jenseits von Wahlen zu denken. Repräsentation soll zu einem 'dynamischen Prozess' werden, dessen Aufgabe es nicht ist, den Willen eines bestehenden Volkes abzubilden, sondern diesen Willen selbst zu konstituieren. Den Repräsentierten werden Vorschläge vorgeführt, wie sie sich konzipieren könnten, das heißt welche politische Identität ihnen für welche Forderung als zweckmäßig erscheint. Repräsentiert wird nicht gemäß einer Identität, die es bereits gibt, sondern es wird eine Identität produziert und zur Verfügung gestellt. Insofern bräuchte die Frage danach, wer das Volk der Repräsentation ist, nicht im Vorhinein beantwortet zu werden, sondern würde erst durch den Repräsentationsprozess selbst bestimmt. Die Krise der Repräsentation wäre dann nicht Ausdruck des Problems, dass sich der Demos der Demokratie nicht finden lässt, sondern würde im Versuch, dieses Problem zu lösen, wiederbelebt werden.
Diese Idee wird von einer Perspektive aufgegriffen und radikalisiert, die die konstituierende Macht des Volkes in den Mittelpunkt stellt: Das Volk ist dann souverän, wenn es sich zu einem Volk konstituiert. Mit dieser Sicht auf Demokratie sind ihre Grenzen nicht bereits gesetzt, sondern ihre Setzung wird zur ersten politischen Frage. Eine unbestimmte, unbegrenzte Kraft des Volkes bildet den Anfang der Politik. Demokratie kann in diesem Modell nicht innerhalb bestimmter Grenzen ausgeübt werden, sondern enthält immer die Überschreitung und Neusetzung dieser Grenzen. Während die grenzenlose Souveränität einer solchen konstituierenden Bewegung offenbar zwielichtige Implikationen enthält (nicht umsonst berufen sich diese Ansätze auf Carl Schmitts Souveränitätsbegriff), steht dem eine Beschreibung der Gründung entgegen, die sich an Hannah Arendt orientiert. Darin steht der demokratietheoretische Anspruch im Mittelpunkt, dass aus dem deliberativen Prozess der gemeinschaftlichen Gründung eines Kollektivs normative Prinzipien erwachsen, ohne dass sie von außen auferlegt werden (Zur Gründung bei Hannah Arendt schreibt Benjamin Ask Popp-Madsen in diesem Band.).
Die Dimension der Entgrenzung, die in einer Sicht von Demokratie als Konstituierung liegt, ermöglicht es, sie vom nationalstaatlichen Rahmen zu lösen und auf eine transnationale Ebene zu übertragen. Im vorliegenden Band thematisiert diesen Vorschlag insbesondere Kolja Möller. Yunjeong Chois Beitrag kritisiert stattdessen ein radikaldemokratisches Verständnis von Konstituierung, das sich gänzlich vom Anspruch zu lösen versucht, überhaupt eine Ordnung zu etablieren. Adressaten dieser Kritik sind insbesondere Michael Hardt und Antonio Negri, die Demokratie als die konstituierende Kraft der Multitude verstehen, in der die Konturenlosigkeit dieser Menge lebendig gehalten wird. Die Multitude ist keine Einheit und kann niemals Souveränität herstellen oder gar eine Regierungsform ausbilden, doch konstituiert sie sich ständig selbst als fluide, netzwerk- oder schwarmartige Kollektivität. Auf diese Beschreibung einer konstanten Konstituierung hat sich in den letzten Jahren eine Reihe linker Intellektueller gestützt, um die Protestbewegungen im Europäischen Süden oder die Platzbesetzungen von Occupy-Bewegungen zu charakterisieren. Isabelle Lorey etwa spricht bezüglich der 15M-Bewegung in Spanien von Versuchen, neue Formen von Demokratie zu erproben, die sich gegen jede Vereinheitlichung richteten. Stattdessen sollen die Praktiken und Diskussionen während der Platzbesetzungen der Erfindung neuer Kollektivitäten und Allianzen dienen. Diese 'presentist democracy' kann sich immer nur gegenwärtig, im Moment ihrer Ausführung realisieren. Präsenz heißt aber auch, dass alle da sind und keine Ausschlüsse geschehen mögen: Alle, die sich zum Demos zählen, sollen Teil von ihm sein können. In diesem gegenwärtigen Vollzug wird eine neue Ordnung konstituiert, die aber nur im Moment des Vollzugs selbst Bestand hat. Politik wird zur Einheit des puren Moments komprimiert.
Das Problem solcher Perspektiven ist offensichtlich: Wenn tatsächlich keine stabile Verbindung zwischen Einzelnen, keine vereinheitlichende Bestimmung angenommen werden darf, kann überhaupt keine kollektive Handlungsfähigkeit angenommen werden. Es bleibt auch die Frage offen, wie aus Momenten purer Präsenz heraus Strukturen erwachsen sollen. Eine Politik reiner Präsenz kann sich nicht verdauern lassen, deshalb kann sie keine Institutionen begründen oder auch nur auf bestehende einwirken, ohne sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Sie muss sich mit ihrem momenthaften Aufscheinen zufriedengeben und dann verschwinden. Wenn sie hingegen doch Wirkungen zeigen will, muss Politik sich über die freie Aktivität in vereinzelten Momenten hinaus als mit den Institutionen, die sie bedingen und die sie adressiert, verbunden sehen. Demokratie muss auch bedeuten, auf konstituierte Zusammenhänge hinzuarbeiten, anstatt sich ausschließlich jenseits jeder Ordnung zu verorten. Dadurch müssen auch (wenn auch möglicherweise punktuelle) Grenzziehungen akzeptiert werden. Nur so können diese Grenzen auch zum Thema und Gegenstand von Aushandlungen gemacht werden.
Aus diesen Debatten und Problemfeldern begründet sich der Anspruch des vorliegenden Sammelbandes. Auch wenn Demokratie eine gewisse Geschlossenheit voraussetzt, so ist sie immer wieder überschreitenden Bewegungen ausgesetzt, die sie in Frage stellen. Umgekehrt operieren auch diese Bewegungen auf der normativen Grundlage demokratischer Funktionsweisen und Rechtfertigungsnarrativen. Diese Spannung zeigt sich auf drei Ebenen, die auch den Band strukturieren: in der Bestimmung von Normen der Öffnung und Schließung, in der Bewegung von Subjekten sowie in Praktiken der Konstituierung.







