
Usurpation und Autorisierung - Konstituierende Gewalt im globalen Zeitalter
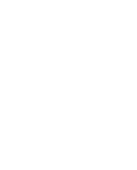
von: Markus Patberg
Campus Verlag, 2018
ISBN: 9783593438610
Sprache: Deutsch
363 Seiten, Download: 1930 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Vorwort Dieses Buch ist das Ergebnis einer langjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema der verfassunggebenden Gewalt jenseits des Staates. Zu Beginn eines (politik-)wissenschaftlichen Projekts ist nicht immer absehbar, ob die ursprüngliche Relevanz einer Fragestellung den Zeitläuften standhalten wird. Auch wenn sich in dieser Einschätzung vielleicht lediglich meine Betriebsblindheit offenbart, scheint mir das Problem der demokratischen Legitimität suprastaatlicher Verfassungspolitik angesichts von Entwicklungen wie den Auseinandersetzungen über Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA, der technokratischen Neuausrichtung der EU während der Eurokrise oder der wachsenden Kritik am Internationalen Strafgerichtshof heute dringlicher denn je. Bei ihren Versuchen, konstitutionelle Ordnungen auf der suprastaatlichen Ebene zu errichten oder zu erhalten, treffen Regierungen zunehmend auf partizipationsorientierten Widerstand der Zivilgesellschaft. Zuletzt hat das Brexit-Referendum die Bürgerinnen der in der EU verbleibenden Staaten mit der Frage konfrontiert, wie sich die Zukunft der europäischen Integration nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs gestalten sollte. Diese Studie ist dem Problem gewidmet, wie sich suprastaatliche Verfassungspolitik als eine Praxis von freien und gleichen Bürgern gestalten ließe. Ihr zentraler Beitrag liegt darin, die Vorstellung eines suprastaatlichen pouvoir constituant einzuführen. Das Buch ist aus meiner Dissertation hervorgegangen, die ich im Februar 2016 an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg eingereicht und im darauffolgenden Juli verteidigt habe. Mein erster Dank gilt Peter Niesen, der das Projekt als Betreuer auf jede erdenkliche Weise gefördert hat. Auch wenn er nicht allen Aussagen des Buchs zustimmt, wird die kundige Leserin seinen Einfluss wohl auf jeder Seite ausmachen können. Meine Anstellungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an seinen Professuren, erst an der TU Darmstadt (2011-2012) und später an der Universität Hamburg (2013-2016), haben mir die Durchführung des Vorhabens ermöglicht und das akademische Umfeld geboten, in dem das Buch entstehen konnte. Ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hat die Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes, die mich bereits während des Studiums und anschließend mit einem Promotionsstipendium unterstützt hat. Mein Interesse an konstituierender Gewalt jenseits des Staates geht auf das Gesellschaftswissenschaftliche Kolleg 'Gesellschaft und Staat im Wandel' zurück (2009-2011), wo ich Mitglied der von Bardo Fassbender und Angelika Siehr geleiteten Arbeitsgruppe 'Die Umgestaltung des Völkerrechts zum Verfassungsrecht der internationalen Gemeinschaft' sein durfte. Bei der Ausarbeitung des methodischen Vorgehens habe ich von einem Forschungsaufenthalt am University College London (2012-2013) profitiert, wobei mein Dank meinem Gastgeber Richard Bellamy sowie Laura Valentini gilt, die den Kurs 'Methods for PhD Students in Political Theory' koordiniert hat. Besonders danken möchte ich zudem Jürgen Habermas, der sich Zeit für zwei ausführliche Gespräche über rationale Rekonstruktion und verfassunggebende Gewalt in der Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaats genommen hat. Wichtige Anregungen habe ich außerdem von Antje Wiener erhalten, der Co-Betreuerin meiner Dissertation im Rahmen der Graduate School, sowie von Michael Zürn und Bill Scheuerman, die das Zweit- und Drittgutachten angefertigt haben. Von großer Hilfe waren auch die unzähligen Kommentare, die ich bei Kolloquien, Workshops und Konferenzen erhalten habe, unter anderem von Jelena von Achenbach, Friedrich Arndt, Jan Pieter Beetz, Jan Brezger, Hauke Brunkhorst, Andreas Busen, Simone Chambers, Ben Crum, Detlef von Daniels, Dorothea Gädeke, Felix Gerlsbeck, Eva Hausteiner, Daniel Jacob, Regina Kreide, Joseph Lacey, Bernd Ladwig, Mattias Kumm, Ingeborg Maus, Kolja Möller, Luise Müller, Antoinette Scherz, Cord Schmelzle, Maximilian Schormair, Kahraman Solmaz, Jens Steffek, Thorsten Thiel, Frieder Vogelmann, Christian Volk, Hans Vorländer, Alexander Weiß und Christopher Zurn. Beim Korrekturlesen hat mich Gilbert Knies unterstützt. Auch allen anderen, die mir in diesem Moment nicht einfallen, danke ich herzlich. Getreu der Regel, dass die bedeutendste Person am Ende genannt wird, können diese Ausführungen nur mit Svenja Ahlhaus enden, die nicht nur in akademischer Hinsicht meine wichtigste Gesprächspartnerin ist. 1. Einleitung: Konstitutionalisierung zwischen Usurpation und Autorisierung Die Idee der verfassunggebenden Gewalt wird heute weithin für überholt gehalten. Die vermeintlich paradoxale und mythische Kategorie erscheint ungeeignet, um das Verhältnis zwischen Bürgern und Verfassung in modernen demokratischen Rechtsstaaten legitimitätstheoretisch zu bestimmen. Die zunehmende Verlagerung politischer Entscheidungstätigkeit auf die Ebene jenseits des Staates ist nur geeignet, diesen Eindruck zu festigen. Wenn die Vorstellung einer konstituierenden Gewalt bereits mit Blick auf innerstaatliche Zusammenhänge verzichtbar zu sein scheint, wie sollte ihr dann Bedeutung für die Analyse politischer Prozesse zukommen, die sich zwischen verfassten Gemeinwesen abspielen? Die Ausgangsintuition der vorliegenden Untersuchung ist, dass diese Skepsis völlig fehlgeleitet ist. Der politische Raum jenseits des Staates ist in den vergangenen Jahrzehnten zum Schauplatz folgenreicher Prozesse der Verfassungsbildung geworden, in denen die Bedingungen der Ausübung öffentlicher Gewalt modifiziert werden. Dieses empirische Phänomen impliziert demokratietheoretische Probleme, die überhaupt erst vollständig freigelegt und einer Lösung zugeführt werden können, wenn die Internationale Politische Theorie (IPT) die Idee der konstituierenden Gewalt für die suprastaatliche Ebene neu entwickelt. Unter einer Verfassung wird konventionell die rechtliche Grundordnung eines politischen Systems verstanden. Der Zweck konstitutioneller Normen liegt darin, Träger öffentlicher Gewalt einzurichten und die regulierte Bearbeitung gesellschaftlicher Problemlagen zu ermöglichen. Als Verfassungspolitik können diejenigen Prozesse gelten, in denen die Spielregeln kollektiv verbindlichen Entscheidens selbst zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung gemacht werden - sei es im Gründungsmoment oder bei Revisionen einer konstitutionellen Ordnung. Aufgrund dieser herrschaftsstrukturierenden Funktion assoziiert die Demokratietheorie verfassungspolitische Vorgänge mit speziellen Anforderungen der Autorisierung. Die Verfassung soll auf eine Entscheidung der Adressaten öffentlicher Gewalt zurückzuführen sein. Umgekehrt ist von Usurpation die Rede, wenn die falschen Akteure oder inadäquate Prozeduren zum Zuge kommen. Inzwischen ist auch auf der Ebene jenseits des Staates die Proliferation von Normen zu beobachten, die in funktionaler Äquivalenz zu staatlichen Verfassungen dazu dienen, Kompetenzen zur Ausübung öffentlicher Gewalt, das heißt zum Treffen rechtsverbindlicher Entscheidungen, zu generieren, zu transferieren und zu beschränken. Die Prozesse, in denen entsprechendes Recht gesetzt oder geändert wird, können als suprastaatliche Verfassungspolitik bezeichnet werden. Ein wesentliches Merkmal suprastaatlicher Verfassungspolitik liegt darin, sich in der Interaktion bereits verfasster Gemeinwesen zu vollziehen. Es sind die Staaten, die seit der Gründung der Vereinten Nationen (UN) sukzessive von ihren völkerrechtlichen Kompetenzen Gebrauch machen, um Strukturen regionaler und globaler Integration zu errichten, Individuen und politischen Gemeinschaften Rechte und Pflichten zuzuweisen und internationale Institutionen mit Entscheidungsbefugnissen auszustatten. Die Etablierung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) oder des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) können ebenso als Ausdruck der verfassungspolitischen Aktivität der Staaten gelten wie die Gründung und Reformen der Europäischen Union (EU), die Verabschiedung der UN-Menschenrechtspakte oder die Einrichtung des Streitbeilegungsmechanismus der Welthandelsorganisation (WTO). Mit dieser neuen Form der Verfassungspolitik sind alte Gewissheiten infrage gestellt. Insbesondere ist unklar, wann auf der suprastaatlichen Ebene von der demokratischen Legitimität konstitutioneller Normsetzung auszugehen ist. Bislang sind es exekutive Eliten, die das Gros der Entscheidungsgewalt für sich beanspruchen - ohne jedoch über ein ausdrückliches Mandat für verfassunggebende Politik zu verfügen. Eine zentrale These der vorliegenden Untersuchung lautet, dass der gängige Modus suprastaatlicher Verfassungspolitik als eine Usurpation verfassunggebender Gewalt aufgefasst werden sollte. Nach klassischer Vorstellung ist es pouvoirs constitués untersagt, ihre Operationsweise eigenmächtig zu ändern, das heißt den Rahmen der ihnen vom pouvoir constituant zugewiesenen Kompetenzen zu modifizieren. Diese Anforderung konnte als halbwegs erfüllt gelten, solange konstitutionelle Normsetzung ein auf die staatliche Ebene beschränktes Phänomen war. Das Auftreten suprastaatlicher Verfassungspolitik führt nun dazu, dass sich öffentliche Gewalt zunehmend gegenüber ihren Adressaten verselbstständigt. Verfasste Gewalten, allen voran die Exekutiven von Staaten, operieren als verfassunggebende Akteure und reorganisieren die Formen kollektiv verbindlichen Entscheidens, denen die Bürger unterworfen sind. Diese Kritik einer Selbstprogrammierung öffentlicher Gewalt wirft die Frage auf, wie ein den heutigen Verhältnissen angemessener Modus der Autorisierung konstitutioneller Normsetzung aussehen könnte. Unter welchen Voraussetzungen könnten Prozesse suprastaatlicher Verfassungspolitik demokratische Legitimität beanspruchen? Auf diese Herausforderung reagiert dieses Buch mit der Vorstellung eines suprastaatlichen pouvoir constituant. Welche Gefahren dem exekutivzentrierten Modus suprastaatlicher Verfassungspolitik innewohnen, wurde mehr als deutlich, als der UN-Sicherheitsrat Anfang der 2000er Jahre im Zuge der Terrorismusbekämpfung eigenmächtig begann, quasilegislative Entscheidungen zu treffen (Talmon 2005). Die beschlossenen Maßnahmen (blacklisting) implizierten bekanntermaßen drastische Verletzungen der Menschenrechte und hatten in Gestalt der Fälle Kadi I und Kadi II einen bis ins Jahr 2013 reichenden Verfassungskonflikt mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Folge (Hoffmann 2008; Avbelj u.a. 2014). Jean Cohen hat das Vorgehen des Sicherheitsrats als eine 'usurpation of global constituent power' beschrieben und damit ein Problem auf den Punkt gebracht, das in den (wichtigen und berechtigten) Diskussionen über die menschenrechtlichen Konsequenzen der damaligen Resolutionen für gewöhnlich untergeht (2012: 278): Die Selbstzuschreibung von Gesetzgebungsbefugnissen durch ein intergouvernementales Gremium stellt (auch unabhängig von Rechtsbrüchen) eine Ausübung konstituierender Gewalt durch nicht-autorisierte Akteure dar. Woran es der IPT bislang fehlt, ist eine fundierte Antwort auf die Frage, wessen verfassunggebende Gewalt eigentlich usurpiert wurde und auf welche Weise sich ein suprastaatlicher pouvoir constituant legitim zur Geltung bringen könnte. Auch die jüngere Entwicklung der EU eignet sich, um die Bedeutung des Themas für reale politische Vorgänge zu veranschaulichen. Wenngleich die EU-Verfassungspolitik von jeher eine regierungszentrierte Angelegenheit war, ist der Gestaltungsspielraum der Exekutiven zuletzt in besonderer Deutlichkeit zutage getreten (Puetter 2015; Crum/Curtin 2015). Im Zuge der Eurokrise kam es nicht nur zu signifikanten Kompetenztransfers von der mitgliedstaatlichen auf die europäische Ebene, sondern auch zu Machtverschiebungen innerhalb des institutionellen Gefüges der EU, die sich zugunsten von Instanzen auswirkten, die keiner elektoralen Verantwortlichkeit unterliegen (Dawson/de Witte 2013; Menéndez 2014; Closa 2015). Diese Veränderungen wurden nicht auf den Pfaden der regulären Vertragsänderung herbeigeführt, sondern sind das Resultat informeller Formen der Verfassungspolitik, etwa der Tolerierung neuer institutioneller Praktiken oder intergouvernementaler Vereinbarungen außerhalb des politischen Systems der EU. Die Durchsetzung dieser Maßnahmen unter Verweis auf die existenzielle Bedrohung der Eurokrise ist treffend als eine Politik des Ausnahmezustands beschrieben worden (J. White 2015; Kreuder-Sonnen 2016), aber die IPT hat es bislang versäumt, die Exekutivzentriertheit dieser Vorgänge und die darin zum Ausdruck kommende Vorherrschaft verfasster Gewalten in der konstitutionellen Normsetzung grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. Nichtsdestoweniger wird der bürgerferne Modus der EU-Verfassungspolitik inzwischen als ein wesentliches Hindernis für eine erfolgreiche Zukunft der europäischen Integration betrachtet. Der Umstand, dass die konstitutionelle Ordnung der EU, insbesondere ihre ökonomische Grundausrichtung, für demokratische Revisionen unzugänglich ist, gilt als eine Ursache für die zunehmende Euroskepsis (Dawson/de Witte 2016). Durch die Brexit-Entscheidung hat sich die Situation noch einmal verschärft. Für die in der EU verbleibenden Staaten stellt sich die Frage, wie ihre Bürgerinnen über die Zukunft des supranationalen Gemeinwesens nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs befinden könnten. Die Idee eines demokratischen Neuanfangs drängt sich auf: 'Today it feels that the longterm future of Europe [...] might well depend on the kind of democratic refounding that a popular initiative implies' (Walker 2016a: 128). Doch während weitgehend Einigkeit hinsichtlich der Notwendigkeit einer konstitutionellen Erneuerung besteht, herrscht Ratlosigkeit, wie sich der angestrebte Wandel als ein Vorgang politischer Selbstbestimmung organisieren ließe. Eine Denkbarriere, an der die Entwicklung innovativer Formen der EU-Verfassungspolitik scheitert, ist die traditionelle Auffassung, verfassunggebende Gewalt sei eine an die Ordnungsform des Staates gebundene Größe. Studien zur Politisierung internationaler Institutionen legen nahe, dass letzten Endes nicht nur die normative Dignität, sondern auch die faktische Stabilität konstitutioneller Ordnungen davon abhängen könnte, ob es zu einer Umstellung auf einen demokratischen Modus suprastaatlicher Verfassungspolitik kommt (Ecker-Ehrhardt/Zürn 2013). In der EU sind es Ereignisse wie die griechischen und spanischen Protestbewegungen (aganaktismenoi, indignados) gegen die Politik der Troika, die Blockupy-Kundgebung anlässlich der Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank (EZB) oder eben das Brexit-Referendum, an denen sich die öffentliche Infragestellung konstitutioneller Normen ablesen lässt (Rauh/Zürn 2014; Statham/Trenz 2015). Und auch außerhalb der EU kann sich der exekutivzentrierte Modus suprastaatlicher Verfassungspolitik längst nicht mehr auf einen permissiven Konsens stützen. Spätestens seit Beginn der 1990er Jahre formiert sich partizipationsorientierter Widerstand, wobei die globalisierungskritischen Demonstrationen nur die medial prominenteste Variante darstellen (O'Brien u.a. 2000; della Porta/Mattoni 2014; Daase/Deitelhoff 2017). Das zivilgesellschaftliche Streben nach konstitutioneller Gestaltungsmacht stellt die verfassungspolitischen Privilegien der Exekutiven infrage. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Situation zu einer Legitimationskrise zuspitzen könnte, sollten diese Aspirationen unbeantwortet bleiben (Reus-Smit 2007; Brunkhorst 2012: 199-200). Angesichts dieser komplexen Konstellation ist diese Studie dem Ziel gewidmet, die Voraussetzungen für die demokratische Legitimität supra-staatlicher Verfassungspolitik systematisch zu bestimmen. Zu diesem Zweck soll die klassische Vorstellung verfassunggebender Gewalt für das globale Zeitalter revidiert werden. Die zentrale Fragestellung lautet: Wer ist Subjekt konstituierender Gewalt jenseits des Staates und unter welchen Bedingungen könnte sich ein suprastaatlicher pouvoir constituant legitim artikulieren? Dieses theoriebildende Projekt soll einen Beitrag zum Global Constitutionalism leisten, einem Teilgebiet der IPT, das trotz seiner hohen Ausdifferenziertheit durch eine verfassungspolitische Leerstelle gekennzeichnet ist und das Problem der (mangelnden) Autorisierung konstitutioneller Normsetzung ausblendet. Um dieses Defizit zu verdeutlichen, soll nun zunächst der Forschungsstand des Global Constitutionalism aufgearbeitet werden, wobei den Gründen dafür nachgegangen wird, dass die unterschiedlichen Ansätze die verfassungspolitische Frage vernachlässigen und bislang kein fundiertes Verständnis verfassunggebender Gewalt hervorgebracht haben (1.1). Danach werden die demokratietheoretischen Vorannahmen erläutert, von denen das vorliegende Projekt ausgeht (1.2). Abschließend wird der Aufbau der Untersuchung anhand der Inhalte der einzelnen Kapitel vorgezeichnet (1.3). 1.1 Verfassungspolitik - Leerstelle des Global Constitutionalism Unter Global Constitutionalism kann man ein interdisziplinäres Forschungsgebiet der IPT verstehen, dessen zentrales Thema die Ausbreitung von Normen konstitutionellen Charakters auf der Ebene jenseits des Staates ist. In den entsprechenden Studien von Rechts- und Politikwissenschaft spielen Aspekte von Demokratie, Menschenrechten und rule of law eine hervorgehobene Rolle. Im Kern geht es dem Global Constitutionalism also um klassische Probleme der rechtlichen Einhegung und (demokratischen) Legitimierung politischer Macht, wie sie aus dem staatlichen Kontext vertraut sind (Walker 2008; Klabbers u.a. 2009; Dobner/Loughlin 2010; Kleinlein/Peters 2014). Vor diesem Hintergrund könnte man erwarten, dass das Problem der Autorisierung konstitutioneller Normsetzung eine zentrale Rolle spielt. Doch weit gefehlt: Verfassungspolitik ist der blinde Fleck des Global Constitutionalism. Kaum einmal wird die demokratische Legitimität der Prozesse hinterfragt, in denen konstitutionelle Ordnungen jenseits des Staates gestaltet werden. Die folgende Systematisierung der Debatte soll diese Leerstelle und ihre unterschiedlichen Facetten verdeutlichen und auf diese Weise die Frage des suprastaatlichen pouvoir constituant im übergreifenden Forschungszusammenhang verorten. Der Global Constitutionalism ist sowohl in methodischer als auch in theoretischer Hinsicht durch ein hohes Maß an Pluralismus gekennzeichnet. Angesichts dieser Heterogenität bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, den Diskurs zu ordnen. Zum Beispiel lassen sich unterschiedliche Figuren globaler Verfassung differenzieren. Einschlägige Dichotomien kontrastieren beispielsweise Vorstellungen von Zuständen der Verfasstheit mit dem Bild eines fortlaufenden Prozesses der Konstitutionalisierung (Wahl 2002: 195; Bryde 2003: 62) oder monistische mit pluralistischen Konzeptionen konstitutioneller Ordnung (Walker 2015: 88). Andernorts werden die konkurrierenden Positionen danach sortiert, ob sie die Proliferation konstitutioneller Normen retrospektiv konstatieren oder prospektiv avisieren (Kadelbach/Kleinlein 2006: 236), oder mittels welcher Argumentationsstrategien (zum Beispiel semantische Verschiebung vs. Aufzeigen funktionaler Analogien) sie die Anwendung von Verfassungsterminologie auf rechtliche Strukturen jenseits des Staates verteidigen (Diggelmann/Altwicker 2008: 632-633). Zudem wird im Zuge der Konsolidierung des Feldes zunehmend versucht, Schulen des Global Constitutionalism zu identifizieren, wobei die verschiedenen Projekte in erster Linie anhand der zugrunde liegenden Forschungsparadigmen gruppiert werden (Wiener u.a. 2012: 6-10; Peters 2015: 1484-1485). Damit sind die denkbaren Varianten keineswegs erschöpft. Zum Beispiel könnte man das Feld entlang der beteiligten (Sub-)Disziplinen strukturieren, wobei die Völkerrechtswissenschaft, die Internationalen Beziehungen (IB) sowie die Politische Theorie an erster Stelle zu nennen wären. Zu einer detaillierteren Systematisierung würde eine Unterscheidung anhand der theoretischen Zugänge (zum Beispiel Diskurstheorie, Systemtheorie) oder ideengeschichtlichen Traditionen (zum Beispiel Liberalismus, Republikanismus) führen, vor deren Hintergrund die Verfassungsfrage in Augenschein genommen wird. Eine weitere Option wäre, die Einteilung an den jeweils behandelten rechtlichen und institutionellen Ordnungen auszurichten. Geht es um die EU, die UN, die WTO, das Menschenrechtsregime, das Investitionsschutzrecht oder die Völkerrechtsordnung insgesamt? Ebenfalls denkbar wäre eine Gruppierung auf der Grundlage konkreter Problembezüge, etwa zur Kadi-Entscheidung des EuGH oder zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ferner könnte man versuchen, Global Constitutionalism von verwandten Forschungsdebatten abzugrenzen, etwa denjenigen über internationale öffentliche Gewalt (International Public Authority) und globales Verwaltungsrecht (Global Administrative Law). Auch ein Überblick über prominente Kritiken könnte zur Orientierung und zur Schärfung des Profils beitragen. Die Nützlichkeit solcher Systematisierungen hängt von den mit der Analyse verfolgten Intentionen ab. Im Folgenden wird das Feld entlang einer Unterscheidung zwischen diagnostischen, explanativen und normativen Ansätzen aufgeschlüsselt. Vorweg sei gesagt, dass diese Kategorien Überschneidungen aufweisen und nicht immer die eindeutige Zuordnung von Positionen erlauben. Nicht selten kombinieren einzelne Studien Elemente mehrerer Ansätze. Trotzdem lässt sich in der Regel ein vorrangiges Forschungsinteresse ausmachen, das den Ausschlag für die Einteilung gibt. Das Schema zeigt die unterschiedlichen Aspekte der verfassungspolitischen Leerstelle des Global Constitutionalism auf. Der diagnostische Ansatz stellt die Proliferation von Normen konstitutioneller Qualität fest, sieht aber davon ab, ihre Genese kritisch zu hinterfragen. Der explanative Ansatz widmet sich den sozialen Voraussetzungen sowie der Funktionsweise demokratischer Mechanismen suprastaatlicher Verfassungspolitik, versäumt aber, vorweg zu bestimmen, welche Formen der Autorisierung überhaupt geboten erscheinen. Der normative Ansatz kritisiert die Inhalte konstitutioneller Normen und präsentiert Entwürfe für eine verfasste Weltordnung, lässt aber die Frage links liegen, wie die Bürger verfassungspolitisch aktiv werden könnten, um die angestrebten Transformationen auf legitime Weise herbeizuführen. Der diagnostische Ansatz Der diagnostische Ansatz, der vorwiegend in der Völkerrechtswissenschaft zu finden ist, versteht Konstitutionalisierung als ein Phänomen, das es zu erfassen und zu beschreiben gilt. Es geht darum, einen Wandel festzustellen, der sich im öffentlichen Recht und - je nach Beurteilung - auch im Privatrecht vollzieht (Thornhill 2012a; Teubner 2012). Um die ins Auge gefassten Entwicklungen zu verdeutlichen, werden Rechtsnormen, denen nach traditionellem Verständnis keine konstitutionelle Qualität zukommt, als Verfassungselemente reinterpretiert. Liegt den Analysen ein systemtheoretischer Zugang zugrunde, wird häufig das globale Recht insgesamt in den Blick genommen (Fischer-Lescano 2005; Kjaer 2014). In der Regel sind es jedoch internationale Institutionen wie die WTO, die EU oder die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), deren rechtliche Grundordnungen auf ihren Verfassungscharakter hin befragt werden (Cass 2005; Isiksel 2016; Viellechner 2011). Jede solche Diagnose setzt Kriterien für die Identifizierung konstitutioneller Normen voraus. Den zahlreichen Varianten ist gemeinsam, dass sie auf inhaltliche oder funktionale Analogien zum innerstaatlichen Verfassungsrecht abstellen, etwa auf den Schutz individueller Rechte, Gewaltenteilung oder Normhierarchie (Dunoff/Trachtman 2009b: 19-21). Ein instruktives Beispiel ist die EU, deren Verfassungscharakter heute kaum noch infrage gestellt wird. Die Auseinandersetzung darüber, ob Europa überhaupt eine Verfassung brauche oder jemals eine haben könne (Grimm 1995; Habermas 1995a), hat man inzwischen weithin zugunsten der Annahme hinter sich gelassen, die EU verfüge über eine Verfassung. Entsprechend ist die Forschung nun primär mit der verfassungstheoretischen und -dogmatischen Durchdringung des Europarechts befasst (Weiler/Wind 2003; Fossum/Menéndez 2011; von Bogdandy/Bast 2011). Zu diesem Fortschreiten des Diskurses haben Diagnosen wie die von Ingolf Pernice und Anne Peters beigetragen, die jeweils mit einem funktionalen Maßstab operieren. Demnach definieren sich Verfassungen über spezifische Leistungen wie etwa die Konstituierung, Organisation, Begrenzung, Verstetigung, Rechtfertigung und Legitimation politischer Entscheidungstätigkeit (Pernice 2001: 159, 163-164; 2009: 365, 372-384; Peters 2001: 76-92). Da die EU-Verträge ebensolche Funktionen für das supra-nationale Gemeinwesen erfüllen, soll ihnen konstitutionelle Qualität zuzuschreiben sein. Umstritten ist heute vor allem, wie die komplexe Beziehung zwischen den Verfassungen der Mitgliedstaaten und der konstitutionellen Ordnung der EU zu verstehen ist, wobei hierarchische und heterarchische Vorstellungen konkurrieren (Walker 2016b). Auf der Ebene des Völkerrechts bilden die Vereinten Nationen einen der zentralen Ansatzpunkte für den diagnostischen Ansatz (Simma 1994; Crawford 1997; Macdonald 2000; Franck 2003). Vereinbarungen wie die UN-Völkermordkonvention sind als world order treaties gedeutet worden, in denen universale Prinzipien der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck kommen (Tomuschat 1993: 269; 1997). Besondere Prominenz hat Bardo Fassbenders Vorschlag erlangt, die UN-Charta nicht nur als Organisationsstatut einer internationalen Institution, sondern als Verfassung des Völkerrechts aufzufassen (1998; 2009). Die Etablierung der UN-Charta sei (wie bereits zuvor die Vereinbarung der Satzung des Völkerbundes) als ein Versuch zu verstehen, 'der internationalen Gemeinschaft eine Verfassung im Sinne einer Verfassungsurkunde zu geben, in der die Grundregeln des Zusammenlebens der Völker kodifiziert werden - und zwar in einer Weise, die diese Regeln für die Zukunft außer Streit stellt und dem individuellen Zugriff der Staaten entzieht' (Fassbender 2004: 1096). Um diese Position zu untermauern, analysiert Fassbender das Gründungsdokument der UN anhand eines Idealtyps der Verfassung, der unter anderem auf deren Höherrangigkeit abstellt. Die UN-Charta führe ein hierarchisches Element ins Völkerrecht ein, da sie mit Artikel 103 ihren eigenen Vorrang etabliere und der Souveränität der Staaten rechtsverbindliche Grenzen setze (Fassbender 2009: 103-107). Das Element der Hierarchisierung steht auch im Mittelpunkt von Diagnosen, die eher auf die Positivierung der Menschenrechte, das ius cogens (zwingendes Völkerrecht) und die Rolle internationaler Gerichte abstellen. Erika de Wet etwa geht von der inkrementellen Herausbildung einer internationalen Verfassungsordnung aus, deren Kern 'Normen des positiven Rechts auf starker ethischer Grundlage' bilden sollen, 'welchen die Staatenpraxis eine Vorrangstellung gegenüber anderen völkerrechtlichen Normen verliehen hat' (de Wet 2007: 778). Mit den UN-Menschenrechtspakten und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) seien fundamentale Ansprüche des Individuums in den Rang bindenden Rechts erhoben worden. Damit einhergehend sei die Entstehung einer Normhierarchie zu beobachten, da zumindest einige dieser Rechte als ius cogens anzusehen seien (de Wet 2006a: 614-618). Wenngleich der Inhalt des zwingenden Völkerrechts nicht festgelegt ist, bestehe Einigkeit hinsichtlich des übergeordneten Status grundlegender Normen des Menschenrechtsschutzes wie beispielsweise des Verbots von Völkermord, Folter, Sklaverei und Rassendiskriminierung. Die konstitutionelle Qualität dieser Normen werde dadurch unterstrichen, dass Instanzen der Rechtsprechung wie der IStGH und der EGMR eingerichtet worden seien, denen die Aufgabe der Durchsetzung zukomme (de Wet 2006b: 59, 64-67). Für solche Diagnosen der Konstitutionalisierung ist charakteristisch, dass die Frage des pouvoir constituant keine Rolle spielt und die demokratische Legitimität der beschriebenen Entwicklungen bestenfalls beiläufig thematisiert wird. Beispielsweise stellen weder Pernice noch Peters die Prozeduren infrage, mittels derer Entscheidungen über die EU-Verfassung (das heißt Änderungen der Verträge) herbeigeführt werden. Pernice äußert sich affirmativ zum intergouvernementalen Modus der parlamentarisch ratifizierten Vertragsänderung (1999: 716-717; 2009: 363) und Peters führt aus, dass 'die Herkunft/Genese und das Erzeugungsverfahren einer Verfassung diese nicht entscheidend legitimieren, sondern die Inhalte' (2001: 496). Fassbender stuft die faktische Dominanz der Exekutiven ebenfalls als unproblematisch ein und führt aus, die Regierungsdelegationen auf der Gründungskonferenz der UN könnten retrospektiv als Treuhänder der verfassunggebenden Gewalt ihrer politischen Gemeinschaften angesehen werden (2007: 286-290). Auch de Wet verzichtet darauf, den Aspekt der Rechtsetzung zu problematisieren, weshalb die Emergenz der völkerrechtlichen Verfassungsordnung bei ihr beinahe naturwüchsig anmutet. Sie begnügt sich mit der Feststellung, die Etablierung konstitutioneller Normen sei offenbar auch ohne einen pouvoir constituant im klassischen Sinne möglich (de Wet 2007: 779).







