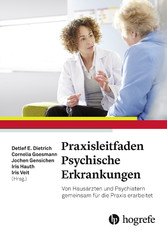
Praxisleitfaden Psychische Erkrankungen - Von Hausärzten und Psychiatern gemeinsam für die Praxis erarbeitet
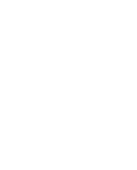
von: Detlef E. Dietrich, Cornelia Goesmann, Jochen Gensichen, Iris Hauth, Iris Veit
Hogrefe AG, 2019
ISBN: 9783456957296
Sprache: Deutsch
408 Seiten, Download: 9471 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Praxisleitfaden Psychische Erkrankungen - Von Hausärzten und Psychiatern gemeinsam für die Praxis erarbeitet
2 Leitsymptome psychischer Erkrankungen
Detlef E. Dietrich, Jochen Gensichen
Es gibt einige Leitsymptome in der psychiatrischen Diagnostik, die pathognomonisch für bestimmte psychische Erkrankung sind. In diesem Kapitel werden die wichtigsten psychiatrischen Symptome (kursiv) in einem Überblick beschrieben und Erkrankungen benannt, auf die diese Symptome differenzialdiagnostisch hinweisen können. Es wird dabei die AMDP-Systematik [3] (AMDP = Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) berücksichtigt und auf die allgemeine Psychopathologie nach Scharfetter [2] Bezug genommen. Grundsätzlich gilt, dass sich viele der psychischen Symptome aus den subjektiven Schilderungen der Betroffenen ergeben (z.B. Stimmenhören), andere nur aus der objektiven Beobachtung durch den Untersucher (z.B. Neologismen) und einige Symptome durch Selbst- und Fremdbeurteilung deutlich werden (z.B. eingeengtes Denken). Eine differenziertere Darstellung einzelner (Leit-)Symptome sowie passende Kasuistiken finden sich in den störungsspezifischen Kapiteln. Auf diese wird jeweils hingewiesen.
Durch ein gezieltes Nachfragen zur psychiatrischen und organmedizinischen Vorgeschichte sowie zum Verlauf der akuten Symptomatik wird die Diagnosestellung erleichtert.
Zusätzlich zur systematischen Anamnese können auch einfache Screening-Fragebögen wie der PhQ-D [1], der insbesondere für die Diagnostik der wichtigsten psychischen Beschwerden in der primärärztlichen Versorgung entwickelt wurde, Anamneseerhebung und Diagnostik erleichtern. Der psychopathologische Befund sollte folgende Aspekte beschreiben:
- äußeres Erscheinungsbild
- Mimik und Gestik
- Bewusstsein und Orientierung
- zwischenmenschliches Verhalten
- Psychomotorik
- Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit und Gedächtnisfunktionen
- Antrieb
- Stimmung
- Denken
- Ich-Erleben
- Suizidalität und Fremdgefährdung
2.1 Bewusstseinsstörungen
Störungen des Bewusstseins werden in quantitative und qualitative Bewusstseinsstörungen unterteilt. Die quantitativen Bewusstseinsstörungen, die Bewusstseinsverminderung, die man als Veränderungen auf einer Schlaf-wach-Skala verstehen kann, sind:
- Benommenheit (der Patient ist verlangsamt und in der Informationsaufnahme und -verarbeitung eingeschränkt)
- Somnolenz (der Patient ist abnorm schläfrig, aber leicht erweckbar)
- Sopor (Patient schläft und ist nur durch starke Reize erweckbar)
- Koma (Patient ist bewusstlos und nicht erweckbar)
Unter den qualitativen Bewusstseinsstörungen versteht man:
- Bewusstseinstrübung (gekennzeichnet durch eine Verwirrtheit von Denken und Handeln, d.h., der Zusammenhang des Erlebens geht verloren, wirkt zerstückelt)
- Bewusstseinseinengung (Einengung des Bewusstseinsumfangs, z.B. im Sinne einer Fokussierung auf ein bestimmtes Erleben bei gleichzeitig vermindertem Ansprechen auf Außenreize, wie z.B. beim epileptischen Dämmerzustand)
- Bewusstseinsverschiebung (Bewusstseinsveränderungen im Sinne von Intensitäts- und Helligkeitssteigerungen oder Bewusstseinssteigerung der Wachheit und der Wahrnehmung intrapersonaler oder externer Vorgänge wie z.B. beim Halluzinogen-Konsum)
Bewusstseinsstörungen sind meist Ausdruck hirnorganischer Veränderungen (Kap. 5.2, Kap. 15.1, Kap. 16.1, Kap. 16.2) oder von Intoxikationen (Kap. 5.2 und Kap. 9.5).
Merke
Bewusstseinsverschiebungen entziehen sich in der Regel der Beobachtung und müssen gezielt erfragt werden.
2.2 Orientierungsstörungen
Orientierungsstörungen sind gekennzeichnet durch ein eingeschränktes Wissen über zeitliche, räumliche, situative und/oder persönliche Fakten:
- Unter zeitlicher Desorientiertheit versteht man das fehlende Wissen über das aktuelle Datum, den Tag, das Jahr und die Jahreszeit.
- Örtliche Desorientiertheit beschreibt das eingeschränkte Wissen darüber, wo sich jemand gerade befindet.
- Bei der situativen Desorientiertheit erfasst der Patient die Situation nicht korrekt, in der er sich gerade befindet (wähnt sich z.B. in der Schule anstatt in der Klinik).
- Bei der Desorientiertheit zur eigenen Person kann der Patient den eigenen Namen, das eigene Geburtsdatum und sonstige wichtige persönliche lebensgeschichtliche Fakten nicht benennen.
Desorientiertheit findet sich in unterschiedlicher Ausprägung insbesondere bei akuten und chronischen hirnorganischen Prozessen (Kap. 3.9, Kap. 5.2, Kap. 16).
Praxistipp
Um eine Bloßstellung der betroffenen Menschen möglichst zu vermeiden, sollten die notwendigen Fragen soweit möglich im Verlauf des Gesprächs geschickt versteckt werden. Eine kreative Gesprächsführung ist hierbei sehr hilfreich.
2.3 Aufmerksamkeit und Konzentration
Unter Aufmerksamkeitsstörungen versteht man eine Beeinträchtigung von Umfang und Intensität der Aufnahme von Wahrnehmung, Vorstellungen oder Gedanken.
Konzentrationsstörungen sind Beeinträchtigungen der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit ausreichend lange auf bestimmte Tätigkeiten, Gegenstände oder Sachverhalte ausrichten zu können. Als orientierende Prüfung der Konzentrationsfähigkeit können einfache Testaufgaben dienen, die hilfreicher sind als die subjektive Beurteilung der Störung. In der Praxis einfach durchzuführen sind z.B. die Aufgaben, eine Zahl fortlaufend zu subtrahieren (z.B. 100 – 7, – 7 usw.), das Buchstabierenlassen längerer Wörter (z.B. Landebahn, Rückhaltebecken) oder das Rückwärtsaufsagen von Monaten oder Wochentagen. Ein Steckenbleiben oder der Abbruch der Aufgabe sind als pathologisch zu werten.
Schwere Konzentrationsstörungen werden subjektiv oft als Gedächtnisstörung erlebt („Ich kann mir nichts mehr merken.“) wie z.B. bei depressiven Störungen (Kap. 7.1, Kap. 7.2).
Konzentrationsstörungen finden sich insbesondere bei hirnorganischen Störungen (Kap. 5.2, Kap. 15.1, Kap. 16.1, Kap. 16.2, Kap. 16.3), bei affektiven Störungen (Kap. 7.1, Kap. 7.2), Intoxikationen (Kap. 5.2, Kap. 9.5) oder bei der Schizophrenie (Kap. 10).
Wenn Wahrnehmungserlebnisse in ihrer Bedeutung nicht begriffen und nicht miteinander verbunden werden können, spricht man von Auffassungsstörungen. Diese werden in der Regel automatisch im Gespräch ermittelt. Hierbei stellt sich die Frage, ob der Betroffene nur konkrete oder auch abstrakte Gesprächsinhalte erfasst. Möchte man dies gezielter untersuchen, kann die Bitte hilfreich sein, ein Sprichwort zu deuten oder eine Bildergeschichte nachzuerzählen.
2.4 Gedächtnis
Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit, neue aktuelle und ältere Erfahrungen wiederzugeben. Unterschieden werden insbesondere Störungen der Merkfähigkeit sowie des Altgedächtnisses, bei differenzierterer Betrachtung werden Ultrakurz- (im Sekundenbereich), Kurzzeit- (im Minutenbereich) und Langzeitgedächtnisinhalte (dauerhaft) unterschieden. Störungen der Gedächtnisfunktionen können meist im Untersuchungsgespräch ausreichend gut abgeschätzt werden. Entweder berichtet der Betroffene selbst über Vergesslichkeit oder man fragt ihn nach Gesprächsinhalten aus dem Beginn des Gesprächs oder den Inhalt des letzten Arztbesuchs („Worüber haben wir bei Ihrem letzten Arztbesuch hier gesprochen?“).
Unter einer Amnesie versteht man eine inhaltliche und zeitlich begrenzte Erinnerungslücke. Bei einer retrograden Amnesie ist ein bestimmter Zeitraum vor dem Ereignis betroffen und bei einer anterograden Amnesie ein bestimmter Zeitraum nach dem Ereignis.
Bei Konfabulationen werden Erinnerungslücken mit Einfällen ausgefüllt, die der Patient selbst für Erinnerungen hält. Unter Paramnesien versteht man verfälschte Erinnerungen wie „Déjà-vu“ (das Gefühl, Situationen schon früher erlebt zu haben) oder „Jamais-vu“ (Situationen noch nie erlebt zu haben). Unter einer transitorischen globalen Amnesie versteht man akute vorübergehende Episoden von Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörungen.
In der klinischen Praxis interessiert insbesondere, wie sich Merkfähigkeit und Altgedächtnis prüfen lassen. Zur orientierenden Beurteilung der Merkfähigkeit kann man z.B. Telefonnummern nachsprechen lassen (5–7 aufeinanderfolgende einstellige Zahlen), 3 Gegenstände benennen lassen, die sofort und etwa nach 2–5 Minuten...








