
Kognitive Verhaltenstherapie der Schizophrenie - Ein individuenzentrierter Ansatz
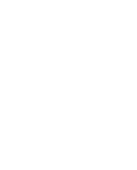
von: Tania Lincoln
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, 2019
ISBN: 9783840929564
Sprache: Deutsch
233 Seiten, Download: 2346 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Kapitel 4 Überblick über Behandlungsansätze
4.1 Klassifikation der Behandlungsansätze
Behandlungsansätze der Schizophrenie lassen sich grob in soziotherapeutische Maßnahmen, medikamentöse Behandlungsansätze und psychologische Interventionen unterteilen, die meist als Einzelbausteine einer integrativen Therapie verstanden werden. Soziotherapeutische Maßnahmen beinhalten unterstützende Rehabilitationsangebote, deren Ziel die Bereitstellung von Hilfen in Bereichen ist, die der Betroffene aus eigenem Vermögen nicht mehr zu bewältigen vermag. Hierzu zählen vor allem die Einrichtung von Wohnheimen und betreutem Wohnen in unterschiedlichen Abstufungen. Ein anderes wichtiges Ziel der Rehabilitation ist die Wiedereingliederung in den Beruf. Dort, wo das nicht möglich ist, soll die Bereitstellung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Belastungsgrenze der Betroffenen berücksichtigen, dem Betroffenen helfen, seine Fähigkeiten weiterhin zu erproben. Im Folgenden wird aber nicht weiter auf soziotherapeutische Maßnahmen eingegangen. Stattdessen soll, nach einer Würdigung und kritischen Bewertung medikamentöser Ansätze, der Fokus auf gängige psychotherapeutische Ansätze gelegt werden. Die kognitive Verhaltenstherapie und ihre Evidenz werden in Kapitel 5 gesondert dargestellt.
4.2 Medikamentöse Ansätze
4.2.1 Akutbehandlung
Der grundsätzliche Wirkmechanismus neuroleptischer Medikation wurde in Kapitel 2.2 beschrieben. Medikamente, in Form von Neuroleptika, leisten für viele Patienten einen wertvollen Beitrag zur Genesung, dies gilt v. a. in der akuten Phase, in der sie für einen halbwegs raschen Rückgang quälender psychotischer Symptome sorgen können. Manche Patienten beschreiben diesen Effekt als „dickere Haut“ oder, wenn er ggf. auch bereits zu stark ist, als „wie in Watte gepackt sein“. Ein symptomreduzierender Effekt der Medikamente ist auch durch viele randomisiert-kontrollierte Studien belegt, bei denen Patienten mit akut psychotischer Symptomatik auf eine Bedingung mit einem bestimmten Neuroleptikum oder eine Placebobedingung randomisiert wurden. Die typische Studiendauer lag bei sechs Wochen, manchmal auch bei drei Monaten, nur in ganz wenigen Fällen ging sie darüber hinaus. Sie deckte somit bei Weitem nicht den gesamten Remissionszeitraum von etwa zwei Jahren ab.
Exemplarisch für eine Reihe von Metaanalysen in diesem Bereich, die überwiegend in den 2000er Jahren publiziert wurden, seien zwei methodisch hochwertige Metaanalysen von Leucht und Kollegen dargestellt: In einer Metaanalyse von 17 qualitativ hochwertigen Psychopharmakastudien, die insgesamt 7.245 Probanden unter Einnahme von Neuroleptika der zweiten Generation untersucht hatten, fanden Leucht, Pitschel-Walz, Abraham und Kissling (1999) im Vergleich zu Placebobehandlungen nur einen geringen signifikanten Effekt von r = 0.25 in Bezug auf Symptomverbesserung. Eine weitere Metaanalyse von Leucht et al. (2009) fand für die Positivsymptomatik eine moderate Effektstärke von d = 0.48 für die Verbesserung über alle psychopathologischen Symptombereiche hinweg. Anders formuliert bedeutet dies, dass neuroleptische Medikation nur für etwa 50 % der Patienten effektiv ist. Legt man verschiedene Metaanalysen und eine strengere Definition von Effektivität im Sinne einer klinischen Relevanz zugrunde, muss man sogar davon ausgehen, dass mindestens 7 Patienten mit Neuroleptika behandelt werden müssen, um bei einem Patienten eine klinisch relevante Veränderung zu erzielen. Zudem wirken die typischen und auch die atypischen Neuroleptika vor allem auf die Positivsymptomatik und bislang weder auf die Negativsymptomatik (Aleman et al., 2017) noch auf kognitive Störungen. An dieser Stelle sei zudem angemerkt, dass aufgrund des hohen wirtschaftlichen Interesses zwar viele pharmakologische Studien durchgeführt werden aber zu erwarten ist, dass der ohnehin bestehende Publikationsbias zugunsten positiver Therapieeffekte durch das Eigeninteresse der Auftraggeber zusätzliche Relevanz erhält. In der Praxis wird in der Regel bei einer mangelnden beobachteten Wirksamkeit nach 2 bis 4 Wochen die Umstellung auf ein anderes Präparat empfohlen.
Allerdings zeigt etwa ein Drittel der Patienten mit Schizophrenie auch beim zweiten oder dritten Neuroleptikum keine ausreichende Reduktion der psychotischen Symptomatik. Deshalb wird häufig auch eine Kombination verschiedener Neuroleptika oder eine Kombination von Neuroleptika mit Benzodiazepinen, Stimmungsstabilisatoren, Antidepressiva oder Beta-Blockern empfohlen. Insgesamt ist jedoch die Evidenzlage für den zusätzlichen Nutzen solcher kombinierten Therapien gegenüber einer Monotherapie mit Neuroleptika immer noch fraglich. Sie wird deshalb in den S3-Leitlinien des AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften)2 nicht empfohlen.
Ein großer Nachteil einer neuroleptischen Medikation besteht zudem darin, dass es häufig zu typischen unerwünschten Begleitwirkungen kommt, die störend, bisweilend auch quälend und sozial beeinträchtigend sind. Dies führt dazu, dass viele Patienten die medikamentöse Therapie ablehnen, abbrechen oder nur unter massiven Druck annehmen. Definiert man regelmäßige Medikamenteneinnahme als eine Einnahme, die in mindestens 75 % der Fälle wie verschrieben erfolgt, dann zeigen Studien, dass etwa 50 % der Patienten die Medikamente nicht regelmäßig einnehmen (Lacro et al., 2002). Nebenwirkungen sind ein wesentlicher Prädiktor für die mangelnde Adhärenz bei der Medikamenteneinnahme aber auch die Überzeugungen der Patienten im Hinblick auf die Ursachen der Störung und die Einstellungen des sozialen Umfelds spielen eine Rolle (Wiesjahn et al., 2014; Moritz, Favrod et al., 2013).







